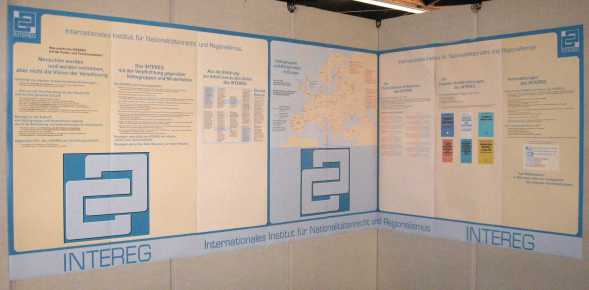Internationales Institut
für Nationalitätenrecht und Regionalismus e.V.
International Institute
for Ethnic Groups Rights and Regionalism
Institut International
pour les droits des groupes ethniques et pour le régionalisme
Istituto Internazionale
per il diritto dei gruppi etnici e il regionalismo
Kisebbségi jogokért és regionalizmus felelős intézet
Međunarodni institut
za prava nacionalih manjina i regionalizam
Интернационални институт
за права националних манјина и регионализам
Unsere Leitgedanken
1.
Angesichts des verbreiteten Strebens nach Selbstbestimmung und Partizipation erscheinen die dem europäischen 19. Jh. zuzurechnenden Lösungsformen des „ethnisch homogenen Nationalstaates“ unzureichend. Der Wille zu gleichrangiger Teilhabe ohne Aufgabe der eigenen Identität auch auf Gruppenebene sowie fallweise Selbstbestimmung stets im Rahmen einer liberalen demokratischen Grundordnung ist für alteingesessene nationale Minoritäten von zentraler Bedeutung. Die Bewahrung der Vielfalt von Kulturen sowie von regional und lokal verorteten Lebenswelten und Identitätsformen ist ein grundlegender kultureller Reichtum und somit für die Zukunft der gesamten Menschheit elementar.
2.
Kaum ein Staat der Welt war und ist „ethnisch“ homogen - trotz oftmalig entgegengesetzter Vorstellungen. Ethnisch, sprachlich, kulturell und religiös unterschiedlich ausgerichtete Bevölkerungsgruppen leben in aller Regel in einem Staatswesen in vielerlei Weise neben- oder miteinander. Bedingt durch diese Unterschiede ist ein beträchtliches Konfliktpotential im Falle einer Krisensituation abrufbar. Die Migrationsströme der letzten Jahrzehnte verändern zusätzlich die nationale und religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung in Europa. Die damit verknüpften massiven Problemfelder verlangen neue Antworten (autochthone und allochthone Bevölkerungsgruppen; Islam).
3.
Ohne ausreichenden Lösungsansatz setzen häufig aus ethnopolitischen und anderen ideologischen Motiven heraus Entrechtung, Terror und Vergeltung gegen bestimmte Volksgruppen ein, die auch zu Vertreibung und dabei partiell auch zum Genozid führten und führen (Sudetendeutsche 1945-1948, Bosnien 1992-1995, Abchasien 1992-1993, Armenier 1915-1921, ethnische „Säuberungen“ und Genozide in Südosteuropa 1912-1923, 1941-1948, Ukraine seit 2014, Berg Karabagh/Arzach 1917-1923 und seit 1989, Südossetien 1991-2008, Zypern 1974 etc.). Ethnisch motivierte Gewalt wird oft auch von dritter Seite beschleunigt und als Rechtfertigung für neue Vertreibungen missbraucht, solange sie nicht verfolgt und bestraft werden.
4.
Die Verlagerung des Minderheitenrechts auf den individuellen Menschenrechtsschutz geht am Kern dieser Frage vorbei: es können Siedlungsgebiete und andere gruppenbezogene Rechte wie die Verwendung der Muttersprache im öffentlichen Raum oder im Schulwesen genommen oder eingeschränkt werden.
Die Vereinten Nationen versuchten erstmalig im Rahmen des Capotorti-Berichtes von 1979 das Projekt einer „Deklaration über die Rechte der Minderheiten“ voranzubringen.
Wir beobachten auch die in den letzten Jahren wieder zunehmende Instrumentalisierung nationaler Minderheiten durch die sog. Kin-States (Russland, Türkei, Ungarn, Serbien etc.).
5.
Als Region mit Vorbildcharakter für die Lösung einiger interethnischer Konflikte in Europa (Korsika, Siebenbürgen, Voivodina, Ukraine, Katalonien etc.) ist neben dem Autonomiemodell der Åland-Inseln in Finnland vor allem Südtirol anzusehen. Mittlerweile wird das dort rechtlich verankerte und umgesetzte Autonomiemodell auch vom italienischen Staat als Beispiel einer zudem wirtschaftlich erfolgreichen Lösung eines regional verorteten Nationalitätenkonfliktes angesehen: Für beide Seiten gilt in diesem Fall die Formel „Mehrwert durch Minderheiten“. Die Regelung der Südtirolfrage steht ferner ganz im Sinne der Europarats-Empfehlung 286 von 2010. Das INTEREG betrachtet diesbezügliche Prozesse in Rumänien, Tschechien, Italien, Ungarn, Slowakei, Litauen, Belarus, Serbien, Nordmazedonien, Ukraine, Slowenien, Kroatien, Kosova/Kosovo, Albanien, Griechenland, Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Polen, Moldova, Montenegro, Zypern, Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Des Weiteren wird der Umgang mit minderheitenbezogenen Themenfeldern in Politik, Wissenschaft und Medien vornehmlich in Deutschland, Österreich und europäischen Institutionen beleuchtet.
6.
Es ist die Auffassung des INTEREG, dass in einem auf die jeweilige regionale Situation zugeschnittenen Nationalitätenrecht und in den Prinzipien von regionaler Demokratie Instrumente von Konfliktentschärfung und Friedenssicherung geschaffen werden können. Überparteilich will das INTEREG einem Rechtsverständnis dienen, das von der freien Entfaltung gewachsener Regionen ausgeht: Beides zusammen erst ermöglicht echte Partizipation der Menschen an der Gestaltung ihrer Geschicke. Die Verlagerung von Kompetenzen auf gewachsene regionale Territorien bedeutet nicht die Auflösung eines Staatswesens, sondern ermöglicht eine in breitere Kreise der Gesellschaft hineinreichende und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Wir lehnen zudem die Vermischung und Gleichsetzung der Anliegen autochthoner Minoritäten mit Forderungen aus dem Bereich der ideologiegeleiteten Gender&Diversity-Bewegungen ab.
7.
Von dieser Sicht und diesen Grundsätzen ausgehend, möchte das INTEREG in Kontakt mit den von diesen Problemen direkt betroffenen Gruppen und entsprechenden Institutionen auf nationaler und internationaler Ebene Vorarbeiten leisten, die aus dem Bereich bloßer momentaner Interessenpolitik herausführen. In Form von Symposien, Publikationen, themenbezogenen Studienfahrten etc. nehmen wir teil an den öffentlichen Diskursen und leisten Bildungsarbeit für Erwachsene.
Gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus München
Kooperationen mit:
Ethnologisches Institut der János-Selye-Universität (Selye János Egyetem, Univerzita J. Selyeho) Komorn/Komárno/Komárom (Slowakei),
Akademie Mitteleuropa e.V. an der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ Bad Kissingen,
Lepsiushaus Potsdam,
Südtiroler Volksgruppeninstitut Bozen,
Bukowina-Institut Augsburg,
Transkarpatisches Ungarisches Ferencz II. Rákóczi Kollegium Beregszász/Berehove (Ukraine)